|
...oder wie rede
ich mit den anderen
1. Kommunikationsstile aus psychologischer
Sicht
Unter Kommunikationsstilen versteht man spezifische Weisen des kommunikative
Verhaltens. Normalerweise verfügen wir über sehr verschiedene
Arten, uns dem Gegenüber kommunikativ zu präsentieren. So
kann man z.B. in Gesprächen ein führendes, beherrschendes
Verhalten vorlegen oder sich mehr zurückhaltend oder vorsichtig
aufführen. Wir können jemandem mehr nach dem Munde reden
oder auf "Kontra" spielen. So wechseln wir unser Verhalten
normalerweise je nach Situation oder Rolle und auch nach dem Verlauf
des Gespräches.
Schulz von Thun unterscheidet aufgrund seiner vor allem therapeutischen
Erfahrung 8 Kommunikations- oder Interaktionsstile, in denen Menschen
sich präsentieren und ihre Kommunikationsbeziehung gestalten:
 den bedürftig-abhängigen Stil
den bedürftig-abhängigen Stil
 den helfenden Stil
den helfenden Stil
 den selbstlosen Stil
den selbstlosen Stil
 den aggressiv-entwertenden Stil
den aggressiv-entwertenden Stil
 den sich beweisenden Stil
den sich beweisenden Stil
 den bestimmenden-kontrollierenden Stil
den bestimmenden-kontrollierenden Stil
 den sich distanzierenden Stil
den sich distanzierenden Stil
 den mitteilungsfreudigen-dramatisierenden Stil
den mitteilungsfreudigen-dramatisierenden Stil
Alle 8 Stile sollen prinzipiell jedem Menschen geläufig sein
und treten natürlich auch "gemischt" auf. Schulz von
Thun interpretiert das alleinige oder überwiegende Auftreten
eines Stils bei einer Person als Ausdruck eines psychischen Problems
(intrapsychische Betrachtungsweise), als seelisches Axiom, das er
jeweils auf die frühkindliche Entwicklung zurückführt.
Im folgenden werden diese Stile kurz vorgestellt. Sie können
weitere Zitate und Beispiele aus
Schulz von Thun aufrufen.

Der bedürftig-abhängige Stil
Erscheinungsbild
"Wer kennt es nicht: das schöne Gefühl, umsorgt und
beschützt zu werden, sich von Großen und Starken behütet
zu wissen, die einem den richtigen Weg weisen und acht geben, dass
nichts Schlimmes passiert?"

Grundpose des bedürftig-abhängigen
Stils

Der helfende Stil
Erscheinungsbild
Menschen, die im helfenden Stil kommunizieren, wollen dem anderen,
besonders dem Bedürftig-Abhängigen, ein starker Partner
sein. Sie können in der Regel gut zuhören, signalisieren
Verständnis und Empathie und bieten Unterstützung an. Gleichzeitig
machen sie deutlich, dass sie stark und kompetent sind.
Die bekannte Redensart vom "hilflosen Helfer" macht allerdings
auch deutlich, dass hinter diesem Stil bei extremer Verwendung ein
Mensch stehen kann, der das Gefühl der eigenen Unsicherheit verbergen
will.
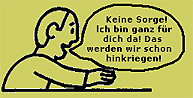
Grundpose des helfenden Stils

Der selbstlose Stil
Erscheinungsbild
"Der selbst-lose Stil ist dem helfenden verwandt. Auch hier besteht
das Grundmuster darin, für andere da zu sein, ihre Wünsche
und Nöte zu erkennen und sich in ihren Dienst zu stellen. Doch
während der Helfer die souveräne Pose anstrebt, sozusagen
"von oben" kommt, hat die aufopfernde Tendenz des Selbstlosen
etwas Unterwürfiges - sie kommt "von unten".
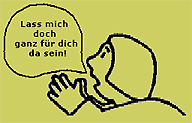
Grundpose des selbstlosen Stils

Der aggressiv-entwertende Stil
Erscheinungsbild
Der Gegenpart zum selbst-losen Kommunikationsstil ist der aggressiv-entwertende
Stil. In ihm sind Elemente des Kampfes, der Konfrontation, des sich
Empörens und der Unerbittlichkeit enthalten. Den anderen herabzusetzen
und zu erniedrigen ist kommunikative Intention dessen, der diesen
Stil benutzt. Dahinter steht der Gedanke, dass man den anderen in
Schach halten müsse, damit man selbst nicht Objekt eines Vernichtungsfeldzuges
werde. Die beiden Bilder zeigen die Grundpose des aggressiv-entwertenden
Stils.
|
|
|
|
Grundpose
des aggressiv-entwertenden Stils (herabsetzend)
|
Grundpose
des aggressiv-entwertenden Stils (beschuldigend)
|

Der sich- beweisende Stil
Erscheinungsbild
Im sich beweisenden Stil will der Kommunizierende dem Gegenüber
durch sein Verhalten kundtun und "beweisen", wie gut und
kompetent er ist. Insofern steht er unter latentem Druck.
Er glaubt, immer wieder andeuten oder sagen zu müssen, dass er
überlegen und wichtig, allseits bekannt und geachtet ist, oder
dass er gebildet, gelehrt wohlhabend o.ä. ist.
Kommen zwei oder mehrere Personen zusammen, die im sich beweisenden
Stil kommunizieren (z.B. Professoren oder Jugendliche in einer Gang...)
entsteht manchmal heftige und auch peinliche Konkurrenz (vgl. den
Werbespruch"Mein Auto, mein Haus, mein Boot").
Sieh her! 
Grundpose des sich-beweisenden
Stils

Der bestimmende - kontrollierende Stil
Erscheinungsbild
Im bestimmend-kontrollierenden Stil macht der Sprechende seinem Gegenüber
klar, dass er (im Gegensatz zum Gegenüber) weiß, was richtig
und gut (für den anderen) ist. Es werden oft moralische oder
Normaussagen verwendet.
Besonders gefärdet, in diesen Stil zu verfallen, sind die Menschen
in pflegerischen oder pädagogischen Berufen, den sie in der gut
gemeinten Absicht, andere weiterzubringen oder ihnen zu helfen gebrauchen.
Die Einstellung zum anderen ist aber nicht nur positiv-fördernd,
er wird zugleich als fehlbares (Mängel-)Wesen, behandelt, das
es zu kontrollieren und (vor sich selbst) zu "bewahren"
gilt.
So wird dieser Stil von Betroffenen oft als "penetrant"
empfunden und abgelehnt.
Bei extremer und nicht situationsangemessener Verwendung, kann dieser
Stil das eigene innere Chaos beim Sprechenden zu kaschieren suchen.

Grundpose des bestimmenden-kontrollierenden
Stils

Der sich distanzierende Stil
Erscheinungsbild
In diesem Stil ist der durchgehende, direkt oder indirekt gegebene
Appell: "Komme mir nicht zu nahe, halte Distanz!"
Dieser Appell wird über eine stark versachlichte Sprache mit
etwas abweisenden Charakter in Gestik und Körperhaltung, aber
auch über protokollarische Schranken wie Vorzimmer, Voranmeldung,
Schreibtischbarriere u.a.m. herübergebracht.
Die Beziehungsseite ist entsprechend auch in den sprachlichen Signalen,
z.B. Signalen der Zuwendung und des Verstehens sehr zurückgenommen,
der Kommunizierende sagt auch wenig von sich.
Hinter einem übermäßigen Gebrauch steht neben Rollenfixierungen
oft auch die Furcht vor Verletzungen..
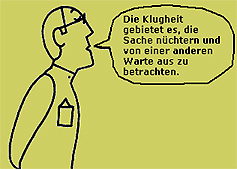
Grundpose des sich distanzierenden Stils

Der mitteilungsfreudige -dramatisierende
Stil
Erscheinungsbild
Wahrgenommen zu werden und sich selbst zu produzieren ist Ziel dieses
Kommunikationsstils. Der in ihm Kommunizierende ist gewissermaßen
immer auf der Bühne, ja, sieht das ganze Leben als eine Bühne.
Deshalb erscheinen solche Menschen oft als redselige Schauspieler.
Bei extremer Nutzung dieses Kommunikationsstils steht oft das Gefühl
dahinter, unwichtig, nicht genügend wahrgenommen zu sein.

Grundpose des mitteilungsfreudig-dramatisierenden
Stils

2. Kommunikationsstile
aus linguistischer Sicht: Gesprächsstile der Geschlechter
Frauen und Männer haben tendenziell eine
andere Sprachverwendung , dies ist durch Forschungen aus den
USA, England, Deutschland und anderen Ländern gezeigt worden.
So gibt es z.B. im Feld Stimme, Aussprache und
Intonation für Frauen die folgenden Erkenntnisse:
Frauen passen sich den sozialen Normen und Erwartungen ihrer Umwelt
mehr an, indem sie eher standardsprachlich sprechen im städtischen
Bereich und dialektal im ländlichen Gegenden. Sie reden oft leiser
und haben spezielle "weibliche" Intonationskurven. Die Frequenz
von Männer- und Frauenstimmen lassen sich nur zum Teil biologisch
erklären (vgl. Graddol/ Swann 1989).
Weiter verfügen Frauen und Männer wegen ihrer oftmals unterschiedlichen
Lebens- und Erfahrungsbereiche über unterschiedliche
Fachwortschätze und unterscheiden sich in bestimmten Wortschatzbereichen.
Dabei drücken sich Frauen häufig gewählter aus, vermeiden
Kraftausdrücke oder schwächen diese ab.
Der Satzbau von Frauen ist eher verbalorientiert,
sie neigen zu kürzeren Sätzen und zeigen Charakteristika
der gesprochenen Sprache in ihren Texten.
Gängigen Vorurteilen widersprechend haben sprachwissenschaftliche
Messungen ergeben, das bei Interaktionen zwischen den beiden Geschlechtern
Frauen meist weniger lang sprechen. Diese Vorurteile von der "geschwätzigen
Frau" entsteht, so wird vermutet, durch unterschiedliche Wahrnehmungsfilter,
die uns beeinflussen.
Die Unterbrechungen von Frauenbeiträgen ist häufiger,
sie bestimmen weniger häufig das Thema des Gesprächs. Männer
neigen zu verallgemeinernden Aussagen (z.B. "man müsste
dringend mal wieder..."), während die Tendenz zu ich - Aussagen
bei Frauen größer ist ("ich finde ..."). Sie
verwenden auch rückversichernde Sprachmittel, sog. tag-questions
(z.B. "nicht wahr?" oder "nicht?") häufiger.
Diese können als Signale einer starken Orientierung an den jeweiligen
Interaktionspartner/innen und als Orientierung an einem auf Konsens
ausgerichteten Interaktionsverhaltens interpretiert werden.
| Aufgrund dieser Ergebnisse kann ein weiblicher
und ein männlicher Sprachgebrauchsstil unterschieden werden,
wobei natürlich auch Männer einen typisch weiblichen
Stil gebrauchen und umgekehrt. Dies ist nicht abhängig vom
Geschlecht, sondern von der sozialen Determinierung. |
Deshalb ist es gefährlich von weiblichen und männlichen
Stil zu sprechen, da damit die traditionellen Rollenstereotype (die
liebevolle-mütterliche Frau und der tatkräftige- kämpferisch
Mann) gefestigt werden.
Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden in Forschungen
aus Schweden so gedeutet, dass diese Reflexe einer geschlechtsspezifisch
unterschiedlichen Umwelt- und Situationsinterpretation sind: So nehmen
Frauen Alltagssituationen häufiger als "Nähe-Situationen"
wahr als Männer, nehmen also Menschen nicht so sehr in ihrer
Rolle als Vertreter/in einer Institution wahr, sondern vielmehr als
Individuum und Privatperson.
Studentische Kleingruppen wurden von Schmidt (1988) untersucht, die
herausfand, dass Frauen eine kooperative kommunikative Orientierung
haben, die Themenbearbeitung gemeinsam vorantreiben und fremde Gesprächsbeiträge
berücksichtigen und unterstützen. Bei Männern überwiegt
die eigene Wissensdarstellung.
Tannen (1990) geht davon aus, dass Frauen sich und andere in einem
Beziehungsmuster eingebettet sehen, das auf
Ebenbürtigkeit, Intimität und horizontale Vernetztheit
beruht. Durch ihr Verhalten zeigen sie ihre Orientierung an dieser
Form von Beziehung. Bei den Männern dominiert die hierarchisierende
Dimension von oben und unten dominiert
und sie streben die Unabhängigkeit an.
Auch das Lachen und Scherzen wird, so Groth (1989) und Kotthoff (1988),
unterschiedlich verwendet: während Frauen mit dem Lachen und
Scherzen andere in Gruppen integrieren, ein
harmonisches und kooperatives Gesprächsklima schaffen,
nutzen Männer dies als Mittel sozialer Kontrolle in Wettbewerbssituationen.
Geschlechtsspezifische Sprachbarriere oder situationsabhängiges
Verhalten der Geschlechter?
Kommen Männer und Frauen in Gesprächen
zusammen, ergibt sich das Problem, dass das weibliche Sprachverhalten
unter Umständen den schulischen und beruflichen Erfolg von Frauen
behindert. So hat der konsensorientierte Stil der Frauen den Nachteil,
dass sie im Gespräch zu kurz kommen, da sie weder ihre Themen
einführen können noch lange genug Redezeit haben, um ihren
Standpunkt darzustellen.
Problematisch ist in Schulinteraktionen,
dass oftmals die Jungen mehr Aufmerksamkeit bekommen, da sie lauter
sind, mehr stören und sich damit die Aufmerksamkeit der Lehrer/innen
sichern. Automatisch kümmern sich die Lehrer/innen mehr um sie
(zwei Drittel ihrer Aufmerksamkeit), während die Mädchen,
die eher angepasst und still sind und gute Mitarbeit leisten nicht
die gleiche Förderung (ein Drittel ihrer Aufmerksamkeit) erhalten.
Es gibt pädagogische Settings, die dieses Ungleichgewicht ausgleichen
wie z.B. die Aufhebung des koedukativen Unterrichts für manche
Fächer wie Mathematik oder Physik, oder Projektarbeit im Unterricht,
der als geeignetste Lernform für einen geschlechtergerechten
Unterricht gesehen wird (Kaiser, A. 1992)

Frauen und Männer müssen Strategien finden, die zur Veränderung
der Geschlechterrollen und Stereotype beitragen, nur so können
sie gleichberechtigt und herrschaftsfrei miteinander interagieren.
Der sogenannte "männliche", d.h. wettbewerbs- und sachorientierte
und weniger integrative Interaktionsstil darf nicht als Norm gesetzt
werden, nach dem sich die Frauen zu richten haben, und auch der sogenannte
typisch weibliche Stil, d.h. der kooperativ, beziehungsorientierte
und integrative Gesprächsstil sollte nicht zur neuen Norm für
die Männer erhoben werden.
Beide Stile sollten in der Kommunikation möglichst verbunden
auftreten. Dann würden sich Männer und Frauen in der jeweiligen
Situation je nach den Kommunikationsgegebenheiten eher "männlich"
oder eher "weiblich" verhalten.

1.7 Körpersprache   1.9
Das ICH in Transaktion 1.9
Das ICH in Transaktion
|