| Das Ich
in der Kommunikation
Obwohl Kommunikation "in Verbindung treten" oder
noch genauer, "sich verständigen" heißt,
gehen die Kommunikationspartner erst einmal von sich aus,
von ihrem ICH.
Das können wir sogar in den Konzepten unserer Sprache
wiederfinden.
Zum Beispiel bei den Personalpronomen ich, du, er, sie,
es, mit denen die Gesprächsrollen benannt werden: ICH
ist der Sprecher, sein "ICH, JETZT, HIER" bestimmt
seine Kommunikation.
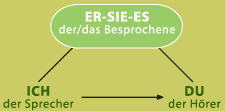
Aber nicht nur bei den Personalpronomen, sondern an vielen
kleinen Stellen findet man in der Sprache den " ich-
jetzt- hier-Ursprung",
so z.B. bei
den Ortspräpositionen
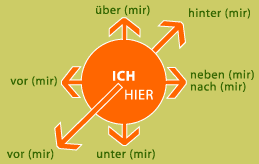
und den Zeitadverbien
sowie den Ortsadverbien:
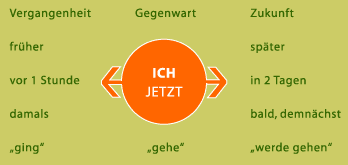
( vgl. Karl Bühler: Sprachtheorie:
ich, jetzt, hier,1934, origo)

Kleine Kinder und Schüler/innen bis zu ca. 9 Jahren
haben als Zentrum des gesamten Weltbildes sich selbst. Sie
können z.B. sich in einer Erzählung nicht vorstellen,
was der andere davon nicht weiß. Sie sind, wie Jean
Piaget (Denken und Sprechen
1930) sagt, "egozentrisch".
Der Entwicklungspsychologe Gerd Mietzel (Mietzel
2001: S.85 weist)
darauf hin, dass
"...eine gewisse Neigung zum egozentrischen Denken
(sic!) im Sinne Piagets... auch in der weiteren Entwicklung
bestehen (bleibt). Pädagogisch ist es sehr wohl wünschenswert,
solchen Neigungen entgegenzuwirken. Mitmenschliche Konflikte
entstehen vor allem, wenn die Beteiligten wenig Bereitschaft
zeigen, die Sichtweise anderer einzunehmen. Bei gezielten
Übungen und durch angemessene Intervention des Lehrers
können Schüler allerdings zur Verminderung ihrer
Egozentrizität veranlasst werden...".
Auch, wenn wir uns auf den anderen einstellen und uns mit
ihm/ihr verständigen wollen, gehen wir immer mit einem
Selbstbild (Selbstkonzept)
in die Kommunikation hinein, welches weitgehend durch Sozialerfahrungen
in Kommunikationen geschaffen wird.
Aus diesem Selbstkonzept
heraus agieren wir und dieses Selbstkonzept wird durch
die Kommunikation und Erfahrungen mit dem/den anderen
mitbestimmt und verändert.
Es ist wichtig, dass wir uns O.K., angenommen und wertgeschätzt,
fühlen.
Es ist aber genauso wichtig, dass wir dieses auch dem
anderen gewähren. |
Mit jeder Kommunikation machen wir dem anderen einen Vorschlag
für eine Beziehungsdefinition und damit auch für
seine eigene Selbstdefinition und geben zugleich unsere
Selbstdefinition kund (Selbstkundgabe).
Je nachdem, wie weit unser Vorschlag für eine Beziehungsdefinition,
bzw. der Vorschlag der Selbstdefinition des anderen angenommen
wird, verläuft die Kommunikation auf der Beziehungsebene
positiv oder problematisch.
Das Bild von sich selbst (das Selbstkonzept) wird heute
als entscheidende Größe für die Entwicklung
der Persönlichkeit und für die seelische Gesundheit
angesehen.
Schulz von Thun (Schulz von
Thun 2001: S.187)
weist darauf hin, dass schon der Tiefenpsychologe Adler
beschrieben hat, "...wie jemand, der nicht viel von
sich hält (Minderwertigkeitsgefühl), sich entweder
entmutigt zurückzieht oder aber, in ständiger
Beweisnot um den eigenen Wert, übersteigert nach Geltung
und Überlegenheit ringt und so den größten
Teil seiner seelischen Energie auf den Kampfplätzen
der Rivalität und der imponierhaften Demonstration
vergeudet."
Mit dieser Tatsache verbinden sich viele Probleme in der
Zwischenmenschlichen Kommunikation. Die Bedeutung eines
negativen Selbstkonzeptes liegt nach Schulz von Thun (Ebd:
S.187) in
folgendem begründet: "Hat es sich erst einmal
verfestigt, dann schafft sich das Individuum eine Erfahrungswelt,
in der sein einmal etabliertes Selbstkonzept immer wieder
bestätigt wird."
"So ist,.." nach Schulz von Thun (Ebd:
S.194) "...mit geradezu verheerenden Auswirkungen...
zu rechnen, wenn ein sehr negatives Selbstkonzept generalisiert
wird, z.B."Mich mag sowieso keiner!" Dies wird
ein (feindseliges oder zurückgezogenes) Verhalten in
Gang setzen, das tatsächlich die Antipathie oder Gleichgültigkeit
der Mitmenschen provoziert."
Petermann und Petermann (Petermann/Petermann
2000: S. 39) definieren das Selbstbild, speziell
auf Jugendliche bezogen als aus folgenden Bereichen zusammengesetzt:
Bereiche des
Selbstbildes (bei Jugendlichen)
- Das Selbst (im Allgemeinen)
- Das psychologische Selbst
- Das soziale Selbst
- Das sexuelle Selbst
- Das familiäre Selbst
- Das adaptierte Selbst

Gesellschaftliche Rollen und Rollenverhalten
Wir alle "spielen" in unserem Leben verschiedene
Rollen, je nachdem, ob wir auf der Arbeit/ in der Schule
sind, in unseren verschiedenen Sozialbeziehungen, auf Ämtern
(Institutionen) oder in Gruppen. Das Spiel ist aber kommunikativ
ziemlicher Ernst.
Die Fähigkeit, im Leben verschiedene, wechselnde Rollen
zu übernehmen und erfolgreich ausfüllen zu können,
ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für positive
und erfolgreiche Kommunikation. Sie ist mit Rollenflexibilität
und sozialkompetenten Verhalten
gut umschrieben und hat keineswegs notwendig mit dem Verlust
von Authentizität und Selbstkonzept zu tun, auch, wenn
dies durch das Verfestigen von ungünstigen Rollenvorstellungen
oder manchmal in Auswirkung von streng institutionalisierten
Rollenzwängen (vgl. z. B. die sog. "Rekrutenschizophrenie"
bei jungen Soldaten) manchmal geschieht.
Rollen werden uns oft durch soziale Normen des Zusammenlebens
insbesondere durch Institutionen und formale Beziehungen
aufgezwungen, meist sind dies dann
hierarchische Rollenkonzepte:
-
Vorgesetzte/r
und Untergebene im Betrieb,
-
Lehrer/in
und Schüler/innen,
-
Kapitän
und Matrosen auf einem Schiff,
-
Polizist/in
und Verkehrsteilnehmer/innen,
-
Offizier/innen
und einfache Soldat/innen im Militär.
Daneben gibt es viele Formen funktionalen
Rollenverhaltens im Bereich
des zweckvolle kooperative Zusammenwirkens
-
von gemeinsam lernenden Schüler/innen
-
von Mann und Frau in einer guten Beziehung
-
von Arbeiter/innen in einer Fabrik
-
von gleichberechtigten Staaten zueinander
Funktionales Rollenverhalten muss aber nicht immer auf Gleichheit
beruhen,
z.B.: das Verhältnis zwischen
-
Verkäufer/in und Kund/innen,
-
Arzt/Ärztin und Patient/innen,
-
von Trainer/in und Spieler/innen.
Auch das Verhältnis von Eltern
zu ihren Kindern ist zunächst einmal ein funktionales,
es kann sich aber zu einem hierarchischen Rollenkonzept
formalisieren, wenn die Eltern aus ihrem Status heraus immer
die Oberhand beanspruchen (und sich dazu dann auch formaler
Hilfestellungen bedienen).
Funktionelle
Beziehungen sind durch kooperatives,
sachgebundenes symmetrisches Verhalten
oder die freiwillige Akzeptanz
der Überlegenheit eines/r Partners/Partnerin in
einem gegebenen Zusammenhang und einer innere Dynamik/Entwicklungsoffenheit
charakterisiert.
Die Grenze zu institutionellen "starren" Rollen
ist zumindest teilweise offen und wird in der Lehrer/in-Schüler/innenbeziehung
auch immer wieder angestrebt und manchmal auch zwischen
Soldat/innen und Offizier/innen als etwas Besonderes
erlebt. |
Wichtig für uns ist die
Fähigkeit zu flexibler Rollenübernahme
(nicht umsonst trainieren kleine Kinder das) und die Verfügung
über ein großes Rollenrepertoire.
Eine Hochschullehrerin kann sich z.B. von einem Sportstudenten
im Fitness trainieren lassen (funktionale Rollen) und dann
seinen Anweisungen strikt folgen, das ändert aber nichts
an den "umgekehrten" Rollen z.B. in einer Prüfung
(institutionelle Rollen).
Bedenkt man das funktionale Rollenverständnis
von Mann und Frau kann man etwas ins Grübeln kommen,
wenn man berücksichtigt man, dass es daneben auch ein
geschlechts-spezifisches Rollenverhalten
gibt. Gemeint sind die oft beschriebenen und heiß
diskutierten unterschiedliche Verhaltensweisen von Jungen
und Mädchen oder Männer und Frauen, besonders
im Umgang und in der Kommunikation miteinander ( Thema
Frauen- und Männersprache).
Die Diskussion über die Phänomene der Unterschiede
ist nicht streitig, wohl aber ihre Ursachen der Unterschiedlichkeiten
(Sozialisation oder Anlage, gesellschaftlich, situationsfunktional
oder wesensbedingt, vgl. auch das Konzept des "doing
gender"). Thema
Frauen- und Männersprache).
Die Diskussion über die Phänomene der Unterschiede
ist nicht streitig, wohl aber ihre Ursachen der Unterschiedlichkeiten
(Sozialisation oder Anlage, gesellschaftlich, situationsfunktional
oder wesensbedingt, vgl. auch das Konzept des "doing
gender").
Mit den Begriffen "Sozialisation" und "gesellschaftlich
bedingt" ist allerdings die wesentliche Veranlassung
für die Ausprägung von Rollenverhalten
und seinem Erwerb angesprochen: Rollen sind das Ergebnis
gesellschaftlicher Differenzierungen und werden weitestgehend
sozial vermittelt. Das Verfügen über ein großes
Rollenrepertoire ist ein wichtiger Ausdruck von Sozialkompetenz.
Die notwendige Balance zwischen Rollenübernahme und
der Bewahrung des eigenen Selbst bildet sich ebenfalls als
Erfahrungen im Umgang miteinander ganz wesentlich heraus.
Entsprechend ist der  Nutzen
des Rollenspiels für die Schuldidaktik. Hier
kann in einem sanktionsfreien Raum eine Vorübung von
Rollenübernahme und eine Ausbildung von Rollenkonzepten
geschehen. Nicht umsonst lieben kleine Kinder Rollenspiele,
so lernen sie verschiedenen Rollen kennen, die für
sie im weiteren Leben wichtig werden. Nutzen
des Rollenspiels für die Schuldidaktik. Hier
kann in einem sanktionsfreien Raum eine Vorübung von
Rollenübernahme und eine Ausbildung von Rollenkonzepten
geschehen. Nicht umsonst lieben kleine Kinder Rollenspiele,
so lernen sie verschiedenen Rollen kennen, die für
sie im weiteren Leben wichtig werden.
Rollenspiele sind deshalb für wesentliche Lebenssituationen
und auch für Konfliktsituationen im didaktischen
Konzept eines Kommunikationstrainings sehr sinnvoll.

1.1 Es geht
immer nach dem Kommunikationsmodell   1.3
Wovon kann ich lernen? 1.3
Wovon kann ich lernen?
|