|
Kommunikation erfolgt
nicht nur über Sprache
Ganz wichtig und ontogenetisch wesentlich älter als die Sprache
ist die Körper"sprache".
Sie ist das älteste Kommunikationsmittel und auch bei Tieren
ausgeprägt vorhanden. Dies ist gut in der Balz, dem Werben
der Tiere, zu beobachten oder in Revierkämpfen und im Rivalitätsverhalten.
Manche Autoren sagen sogar, dass Pflanzen (Blumen u.ä.) über
ein gewisses Maß an Körpersprache verfügen.
Archaische Ausprägungen der Körpersprache
sind stark instinktgeleitet, sind angeborenes oder hochautomatisiertes,
überwiegend reaktives Verhalten: in einer bestimmten Situation
(z.B. beim Zuschlagen eines Boxers) tritt automatisch eine Schutzgeste,
ein Zurückprallen, ein. Über solche Anteile haben wir
wenig Kontrolle, allerdings kann man auch hier Verhalten lernen
und antrainieren: z.B. wird in Frauenselbstverteidigungskursen
den Frauen beigebracht, in bedrohlichen Situationen mit gewaltbereiten
Männern nicht das "natürliche" Angst- und
Opferverhalten zu zeigen, sondern selbstbewusst aufzutreten. Sehr
oft kommt es dann auch gar nicht zur Gewaltanwendung.
Andere körpersprachliche Ausdruckselemente
sind ähnlich wie Sprachzeichen "verabredet" und
müssen ähnlich wie Sprache gelernt werden. Kopfschütteln
oder Kopfnicken kann dann jeweils in verschiedenen Kulturen
auch Unterschiedliches bedeuten. So sind die Begrüßungsgeste
Händeschütteln oder der Wangenkuss ebenfalls künstlich
gesetzte körpersprachliche Zeichen.
Eine Mischung zwischen archaischen und ritualisierten
körpersprachlichen (Ausdrucks)mitteln stellen z.B. Tanzfiguren
oder Bewegungen der Gegner in einem Ringkampf dar: es handelt
sich zum Teil um (zuneigende bzw. abwehrende) Automatismen wie
Engtanzen, Anschmiegen, und Ausweichen, Wegducken. Zum Teil handelt
es sich aber auch um angelernte Rituale wie Schrittfolgen, Tanzfiguren
und Ringkampfgriffe usw.
Es gibt hier einen gleitenden Übergang.
In der Literatur wird oft die Frage erörtert,
wie sprachliche und körpersprachliche
Signale zueinander passen.
Im Axiom 4 von Watzlawick wird für die Sprache eine starke inhaltliche
Leistungsfähigkeit und für die Körpersprache (und
andere analoge Ausdrucksmittel wie Satzmelodie und Sprechtempo)
eine hohe Leistungsfähigkeit in Beziehungsaussagen behauptet.
Axiom 4 von Watzlawick wird für die Sprache eine starke inhaltliche
Leistungsfähigkeit und für die Körpersprache (und
andere analoge Ausdrucksmittel wie Satzmelodie und Sprechtempo)
eine hohe Leistungsfähigkeit in Beziehungsaussagen behauptet.
Allgemein wird der Zusammenfall von sprachlicher und körpersprachlicher
Aussage (beide Botschaften sind gleich oder widersprechen sich
nicht) als authentische Aussage angesehen, die Ausnahmen sind
antrainierte körpersprachliche Signale, die scheinbar Authentizität
zur Schau stellen, siehe dazu unten die einzelnen Körperausdrucksformen.
Im Folgenden werden körpersprachliche
Ausdrucksmittel nach systematischen Kategorien behandelt.
Mimik
Das Spiel der Gesichtsmuskeln ist eines
der wichtigste Ausdrucksformen unserer Emotionen. Mit ihrem Gesicht
kann die sprechende Person ihre Einstellung zu dem Gesagten oder
zu den Gesprächspartner/innen zeigen. Auch erkennt man im
Gesicht am ehesten das Interesse oder Desinteresse am besprochenen
Gegenstand.
Allerdings kann man nicht nur dieses übermitteln, sondern
auch, durch die Beherrschung der Mimik, zurückhalten. So
kann man auch Mimik simulieren, die nichts mit den wirklich empfundenen
Gefühlen zu tun hat. Daher ist das Gesicht nicht nur der
geschickteste nonverbale Kommunikator, sondern kann auch zum besten
nonverbalen Lügner werden.
Emotionen wie Furcht, Ärger, Überraschung,
Freude, Abscheu und Traurigkeit werden über die Mimik ausgedrückt
und sind feststehende Zeichen, die in allen Kulturen verstanden
werden.
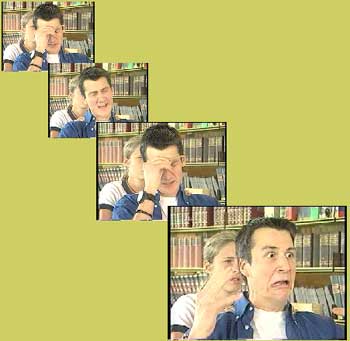
Außerdem gibt es auch Gesichts- und
Kopfgesten, die unabhängig von Emotionen, kulturell bedingt
sind (z.B.: bejahendes Kopfnicken, Zublinzeln).

Blickkontakt
Der Blickkontakt ist für die Organisation
des Sprecherwechsels während eines Gespächs von entscheidender
Bedeutung, der Entzug desselbigen führt automatisch zu einer
problematischen Gesprächssituation. Für die Kommunkation
ist die Häufigkeit, Dauer und Intensität des Blickkontaktes
wichtig. So hat er hauptsächlich eine Steuerungsfunktion
in der Kommunikation, Gesprächspartner/innen können
speziell angesprochen werden.
Mit den Augen können ebenfalls Misstrauen, Einverständnis,
Sympathie/ Antipathie und Aufmerksamkeit signalisiert werden,
wobei der Blickkontakt äquivalent zu physischer Nähe
ist und sich bei größerer Nähe reduziert, um zu
große Intimität zu vermeiden. Im Gegensatz dazu kann
bestimmter Blickkontakt (z.B. scharfes in die Augen sehen) auch
als Dominanzmittel eingesetzt werden.
Man kann unterscheiden zwischen dem einseitigen und gegenseitigen
Anblicken, wobei das sich gegenseitig Ansehen der eigentliche
Blickkontakt ist, bei dem der Blick erwidert wird.
Gestik
Die Position von Händen und Armen spielt
hier neben deren Bewegung eine entscheidende Rolle: die Hände
offen oder verschränkt, sich ans Ohrläppchen fassen,
nahe am Körper oder weiter ausladend gestikulieren, dies
sind alles Formen der Gestik, die mehr oder weniger Raum beanspruchen.
Sie verrät viel über den Gemütszustand des Gesprächpartners,
kann aber auch einstudiert werden, um die Engagiertheit einer
redenden Person zu unterstützen. Handbewegungen regeln auch
den Sprecherwechsel und den Ablauf der Gespräche allgemein.
Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Kommunikationssteuerung
und der begleitenden Illustration einer Botschaft. Ähnlich
wie der Dirigent mit seinem Stab führt man mit Handgesten
(kommunikative) Regie.
Die Intensität der Gestik ist wie bei allen anderen Arten
körpersprachlichen Verhaltens stark kulturabhängig,
Menschen aus anderen Kulturkreisen, z.B: Südeuropa reden
mehr mit den Händen und Armen als Deutsche.
Verschiedene Arten von Gesten werden unterschieden:
- die Sprache begleitende und ergänzende
Bewegung,
- expressive, nicht unbedingt mit der Sprache
zusammenhängende und weniger sozial beeinflusste Bewegung,
- emblematische, symbolische Handbewegungen.
Welche Gestenarten werden in den folgenden
drei Bildern verwendet?
  
Körperhaltung
Die Körperhaltung ist immer auf
die Anordnung der einzelnen Körperteile
einer Person bezogen, während
die Körperorientierung die Anwesenheit eines Interaktionspartners
voraussetzt. So kann dieselbe Körperhaltung unterschiedliche
Bedeutung haben, je nachdem, wer der Kommunikationspartner ist
(z.B. dient lockeres Sitzen auf dem Stuhl in Pausen der Entspannung,
während es im Unterricht als Desinteresse gedeutet werden
kann).
Erwachsene haben gelernt, ihre Mimik zu beherrschen, dem Körper
wird jedoch weniger Aufmerksamkeit geschenkt, so dass das Individuum
seine Befindlichkeit oft durch den Körper unbewusst verrät.
Dabei ist die Zuwendung zum Gesprächspartner und zur Gruppe
entscheidend in seiner kommunikativen Wirkung. So kann diie Körperhaltung
Abneigung/Zuneigung und Interesse/Desinteresse signalisieren.
Auch ob man sich im Gespräch integriert fühlt oder nicht,
ob man präsent ist (breite Sitzhaltung) oder keine wichtige
Rolle spielt (optisches "Dünnmachen") wird ebenfalls
durch die Haltung kommuniziert: sie ist ein Ausdruck des Selbstbildes.
Die Abbildung zeigt geschlechtsspezifisches Sitzverhalten: Die
Männer sitzen breit, nehmen Raum ein, während die Frauen
sich sich dünn machen.

Proxemik
Unter Proxemik versteht man die Raumnutzung
- einerseits die Position in einem Raum und andererseits die Position
zum Kommunikationspartner.
Als Beispiel proxemischer Planung, die uns allen geläufig
ist, können Regieanweisungen für eine Film- oder Theaterszene
gelten.
In der körperlichen Nähe oder Distanz zeigen sich die
Gesprächspartner/innen optisch ihre Nähe bzw. Distanz
zueinander. Auch andere sozialen Beziehungen und Rollenstrukturen
werden durch die räumliche Konstellation ausgedrückt.
Es gibt immer gute und schlechte Plätze, Menschen, die eingequetscht
sitzen oder viel Raum haben, wenn sie in Grüppchen zusammen
stehen oder um einen Tisch herum sitzen. Manche bilden den Mittelpunkt,
werden umringt, andere sind schon rein räumlich nicht richtig
in die Runde integriert.
 
1.6 Die vier Seiten
einer Nachricht
  1.8 Kommunikationsstile
1.8 Kommunikationsstile
|