 Der
sich distanzierende Stil Der
sich distanzierende Stil
Erscheinungsbild, Grundbotschaft und seelischer
Hintergrund
"Wenn wir von der distanzierenden Strömung erfasst sind,
dürfen uns die Mitmenschen nicht zu nahe kommen. Die Grenzen
des eigenen Hoheitsgebietes sind vorverlegt, eine unsichtbare
Wand sorgt dafür, dass der gebührende Abstand erhalten
bleibt. Dies ist zunächst schon rein räumlich und körperlich
gemeint: Eine Scheu, wenn nicht Abscheu vor Berührung sorgt
für den gewünschten "Sicherheitsabstand",
den zum Beispiel Schreib- und Konferenztische, sperrige Vorzimmer
und die Bevorzugung des Schriftverkehrs gewährleisten. Dasselbe
gilt auch seelisch: Im direkten Kontakt ist es Aufgabe des Kommunikationsstils,
Distanz herzustellen. .....
Leicht werden die sich Distanzierenden als arrogant und abweisend
wahrgenommen, beim Gegenüber entsteht der Eindruck, "man
kommt schwer heran an sie" oder "man wird nicht recht
warm mit ihnen." (Schulz von
Thun 1998: S.191 ff)
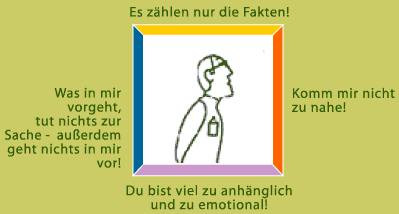
Grundbotschaft des sich distanzierenden
Stils
Die Grundbotschaft hat eine starke
Ausprägung auf der Sach-Seite und eine schwache auf der
Beziehungsseite. Die Selbstkundgabe ist ebenfalls schwach ausgeprägt,
er gibt sich verschlossen. Deutlich hingegen der allwährende
Appell "Komm mir nicht zu nahe!"
"Die ausgeprägte Orientierung auf die sachlichen Aspekte
des Gespräches sei an folgendem Beispiel demonstriert:
Der
(distanzierte) Ehemann kommt nach Hause, seine Frau berichtet
ihm voller Sorgen:
|
| Frau: |
Stell
dir vor, Rüdiger hat wieder eine Fünf geschrieben! |
| Mann: |
In
welchem Fach? |
| Frau: |
In
Englisch - und dabei hatte er so geübt! Vorhin saß
er aufseinem Bett und heulte und... |
| Mann: |
Wie
ist die Arbeit insgesamt ausgefallen? |
| Frau: |
Du,
das weiß ich nicht! Auf jeden Fall ist er völlig
verzweifelt. |
| Mann: |
Nun ja- handelt es sich denn um ein wiederholtes Versagen
oder ist es ein erstmaliger Ausrutscher? |
| Frau: |
Eine
Fünf hatte er bisher, soviel ich weiß, noch nicht,
aber Sorgen mache ich mir
schon. |
| Mann: |
Zunächst einmal muss überprüft werden, ob überhaupt
Anlass für Verzweiflung
und Sorgen bestehen. Und dazu ist es nötig, einmal die
genaue Sachlage zu ermitteln. |
| Frau: |
Für
dich zählen aber immer nur die Fakten! Willst du nicht
mal hochgehen, ihn zu trösten? |
| Mann: |
Äh,
man lässt ihn jetzt besser allein. Nachher kann man dann
in aller Ruhe eine geeignete Problemlösung... |
| Frau: |
In aller Ruhe!! Ich bin aufgebracht, hörst du?! |
| Mann: |
Eben,
und so kommen wir ja nicht weiter.
(Zieht sich zurück)
|
Während der Mann insgeheim die "mangelnde
Sachlichkeit" seiner Frau "mit Bedauern registriert"
(wie er sich vielleicht ausdrücken würde), beklagt die
Frau sein geringes Einfühlungsvermögen und den Mangel
an gefühlsmäßigem Austausch ("Du bist hier
nicht mehr in deiner Bank!"). Tatsächlich wahrt die
distanzierte Sprache nicht nur den Sicherheitsabstand zu seinen
Mitmenschen, sondern auch zu sich selbst. Genauer gesagt: Zu jenen
Bezirken seiner Seele, in denen er seine Gefühle gleichsam
hinter Schloss und Riegel hält....."
"Zwar macht der Distanzierte nach außen
hin den Eindruck, als ob er wenig berührbar wäre, keine
Gefühle hätte - ein Mensch mit großem Kopf und
einem Herzen aus Stein.
Da wir aber inzwischen darin geübt sind, die Außenseite
des Verhaltens immer auch als kompensatorisch, das heißt
als Maßnahme zur Bewältigung innerer Angelegenheiten
zu verstehen, können wir vermuten, dass der Distanzierte
"im Grunde seiner Seele" eine reiche, aber auch allzu
verletzbare und daher schutzbedürftige Gefühlswelt in
sich trägt. Wenn die distanzierende Strömung in einem
Menschen so vorherrschend geworden ist, dass er sich - auch wenn
er möchte - nicht mehr anders geben kann, sind vermutlich
prägende Erfahrungen mit zwischenmenschlicher Nähe die
Ursache hierfür."
|
Das
seelische Axiom lautet dann:
"Wenn ich mich öffne und jemand ganz an mich
heranlasse, begebe ich mich in große Gefahr:
Ich könnte in eine solche Abhängigkeit geraten,
dass ich jeder Verletzung preisgegeben bin und mich selbst
in der Gefangenschaft der Verschmelzung verliere."
|

|