|
Unter dem Begriff "Spiele
der Erwachsenen" versteht man eine Art von Rollenspielen,
in denen auch ohne soziale Notwendigkeit, Konvention und Nutzen
Rollen eingenommen, "gespielt" werden.
Es handelt sich im weiteren Sinne um Rituale,
die ihren ursprünglichen Sinn verloren haben oder von Anfang
an spielerischen Charakter hatten, z.B. Gesellschaftsspiele, Smalltalk
über das Wetter, u.s.w.
Eine besonders extreme Form von Spielen sind
die sog. psychologischen Spiele, wie sie Eric Berne im Rahmen
der Transaktionsanalyse in seinem Buch:
"Spiele der Erwachsenen" beschrieben hat.
| Eric
Berne vertritt die These, dass Menschen
die Neigung haben, ihr Leben im privaten Bereich als ständiges
Spiel zu leben. Die Grundlage für solche Spiele wird,
wie oben angedeutet, durch soziale Verbindungen geschaffen. |
Um Eric Bernes Spieltheorie zu verstehen, muss man sich kurz auf
seine Auffassungen über den angestrebten Nutzen aus sozialen
Verbindungen einlassen.
Ausgehend vom Kleinkind betrachtet Berne den Wunsch nach Streicheleinheiten
als Motor des positiven Lebens auch im Erwachsenenalter.
Er bezeichnet in Anlehnung an archaische Formen des sozialen Umgangs
zwischen Mutter und Kind jede Anerkennung des Gegenübers
als "Streicheln" und sagt, dass das Streben nach Anerkennung
und positiver Annahme in sozialen Verbindungen der Menschen ein
Streben nach Streicheleinheiten ist.
Sogar Auseinandersetzungen können als Streicheleinheiten
gewertet werden, weil es immer noch besser ist, kritisiert zu
werden, als gar nicht beachtet zu werden.
Eric Berne unterscheidet je nach Inhalten sieben
verschiedene Arten von Spielen:
- Lebensspiele
- Ehespiele
- Partyspiele
- Sexspiele
- Räuberspiele
- Doktorspiele
- "gute" Spiele
Die Auflistung mit der Sonderkategorie "gute"
Spiele zeigt, dass die Spiele der Erwachsenen meistens destruktive
Spiele sind.
Spiele werden als eine periodisch wiederkehrende
Folge von Transaktionen beschrieben, die äußerlich
plausibel erscheinen, in Wirklichkeit aber von verborgenen Motiven
beherrscht sind.
Bei den psychologischen Spielen ist immer eine "Falle"
enthalten, die durch das verborgene Motiv bestimmt ist und einen
klar definierten Nutzeffekt hat.
Als Spiel bezeichnet Berne eine Folge verdeckter
Transaktionen, die von einem genau definierten Spielgewinn geleitet
sind. Der in einem Spiel agierende gibt vor, etwas zu tun, während
er in Wirklichkeit etwas Anderes tut:
Ein
Spiel beinhaltet insofern immer auch einen Schwindel.

Voraussetzung ist, dass der Agierende einen
Schwachpunkt beim Gegenüber vorfindet, z.B. Furcht, Leidenschaft,
Sentimentalität, Habgier, an dem er "einhaken"
kann. Der reagierende Partner, das "Opfer" in einem
Spiel bietet durch seine Schwäche einen Ansatzpunkt.
Hat der Agierende eingehakt, betätigt er einen imaginären
Schalter und ruft so bei seinem Opfer ein Moment der Verwirrung
hervor. Anschließend kassieren beide den "Lohn"
des Spiels in Form von unterschiedlichen Gefühlen.
Nach Berne hat ein Spiel vier Merkmale:
- Schwindel
- "Schalthebel"
- Verwirrung
- Lohn
Ablaufdiagramm eines Spieles
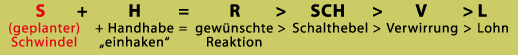
1.9 Das ICH in Transaktion
  Teil
2 Kommunikative Praxis in der Schule und praktische Rhetorik Teil
2 Kommunikative Praxis in der Schule und praktische Rhetorik
|