|
Rhetorik
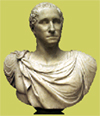
 Einführung
Einführung
 Die fünf Produktionsstadien der öffentlichen Rede
Die fünf Produktionsstadien der öffentlichen Rede
 Rhetorische Figuren und Topoi
Rhetorische Figuren und Topoi
Einführung
Wir alle können reden -nicht zuletzt diese Fähigkeit
macht uns zu Menschen, wie allgemein angenommen wird.
Diese zunächst schlichte Feststellung hat weitreichende
Konsequenzen. Diese wurden bereits in der griechischen und römischen
Antike erkannt, der Zeit, in der die Redekunst entwickelt wurde.
Die großen Theoretiker der
Rhetorik (Aristoteles, Cicero und Quintilian) führten aus,
dass zur "Redefähigkeit" (lat. natura) als Naturanlage
die folgenden zwei Dinge hinzukommen müssen, will der Mensch
nicht nur einfach reden, sondern "gut" reden.
1. KUNST UND WISSEN (lat. ars, doctrina)
Kunst hat hier nun nichts damit zu tun, dass wir ein wirklich
künstlerisches Produkt herstellen, also ein Bild oder ein
Gedicht. Der Begriff bezeichnet vielmehr eine bestimmte, hier
überwiegend verbale Fähigkeit, die Redekunst. Die Kunst,
ein Anliegen in einer gekonnten, präzisen und ansprechenden
Weise formulieren zu können. Diese aber ist nicht natürlich
gegeben, sie muss erlernt und gefestigt werden durch die Übung
im sprachlichen, rednerischen Ausdruck. Zugleich ist es erforderlich,
ein bestimmtes Wissen zu besitzen, wie z.B. bei einem Autokauf
die Autopreise oder den Zustand des Pkws. Aber man muss auch etwas
über das Gegenüber, unseren Kommunikationspartner/ unsere
Kommunikationspartnerin, wissen: Ist er/sie kompromissfähig,
kann er/sie seine Position gut vertreten, hat er/sie selbst Wissen
über den Gegenstand etc. Natürlich muss man sich auch
selbst gut kennen.
2. ERFAHRUNG UND ÜBUNG
(lat. exercitatio)
In alle Gespräche mit anderen bringen wir Erfahrungen verschiedenster
Art ein: über die Sache, um die es geht, aber auch über
früher erlebte Gesprächsverläufe, und nicht zuletzt
das, was wir Menschenkenntnis nennen; diese erwerben wir durch
immer neue kommunikative Situationen des Dialogs, der Auseinandersetzung
und der Übung.
Aber hier geht es noch um etwas Weiteres: Wir können eine
Technik entwickeln, unser Anliegen möglichst verständlich
und überzeugend vorzutragen: durch die Wahl unserer Worte,
aber auch durch Stimmführung, Intonation etc. Mit diesem
Teil beschäftigt sich die  Sprecherziehung. Sprecherziehung.

Historisch entwickelte
sich die Rhetorik vor allem aus der Politik und dem Rechtswesen.
So konnten z.B. Eigentumsstreitigkeiten "vernünftig"
entschieden werden.
An Äußerungsformen in Konflikten können wir auch
heute die Grundformen des Rhetorischen ablesen. Ein Anwalt z.B.
muss über Kunst und Wissen, Erfahrung und Übung verfügen,
um seinen Klienten erfolgreich verteidigen zu können.
Dabei sind zwei Erkenntnisse für
uns wichtig:
-
Menschen
handeln zielorientiert (wenn auch nicht immer und gänzlich).
-
Verschiedene
Menschen (z.B. Anwälte, die gegensätzliche Interessen
vertreten) haben oft unterschiedliche Ziele.
Walter Jens nannte die Rhetorik die
"Kunst des guten Redens (und Schreibens) im Sinne einer von
Moralität zeugenden, ästhetisch anspruchsvollen, situationsbezogenen
und auf Wirkung bedachten Äußerung, die allgemeines
Interesse beanspruchen kann".
Rhetorik ist eine
Erfahrungswissenschaft, die auf kontrollierter und empirisch
nachweisbarer Beobachtung rhetorischer Sprechakte beruht. Sie
versucht die Geltung der aus ihr gewonnenen Erkenntnisse durch
historische Rekonstruktion und die Bildung von Hypothesen über
die Systematik und die Regeln rhetorischen Sprechens zu sichern
(Allgemeine Rhetorik).
Der Begriff Rhetorik
bezieht sich auf die Theorie und Praxis der menschlichen Beredsamkeit
in allen öffentlichen und privaten Angelegenheiten, ob sie
in mündlicher, schriftlicher oder durch die in technischen
Medien (Film, Fernsehen, Internet) vermittelte Form auftritt.
Als wissenschaftliche Disziplin beschäftigt sich die Rhetorik
mit der Analyse sprachlicher oder der Sprache analoger Kommunikation
(körperliche Beredsamkeit), die wirkungsorientiert, also
auf die Überzeugung des Adressaten hin ausgerichtet ist (persuasive
Kommunikation).
Ziel der Rhetorik
ist es seit ihrem Beginn, andere Menschen - Vertragspartner, ein
Publikum, das Gericht, überhaupt eine Zuhörerschaft
- zu überzeugen oder auch zu überreden. Beides wird
mit dem lateinischen Begriff der PERSUASIO bezeichnet. Daraus
ergeben sich auch die Formen, mit denen diese persuasive Wirkung
erzielt werden soll:
- die rationale Überzeugungsarbeit mit Argumenten,
- die emotionale, affektive Einwirkung auf das Publikum.
Beides macht die Stärke der rhetorischen Kommunikation aus.
Gerade aber gegenüber der emotionalen Überredung gab
es auch immer wieder Kritik: Rhetorik erschien als Anleitung zur
Lüge und der Manipulation, was sie natürlich auch sein
kann, wie etwa die Reden von Hitler oder von anderen Demagogen
zeigen.

Die
fünf Produktionsstadien
der öffentlichen Rede bilden das wichtigste systematische
Einteilungsprinzip der Rhetorik. Diese Arbeitsschritte
sind grundlegend für fast jede Art und regeln die
Ausarbeitung eines Kommunikationsaktes vom Auffinden
der Gedanken bis zum medialen Vortrag.
|
| Inventio: |
Am
Anfang steht die Erkenntnis des Themas, seine Zuordnung
zu einer der drei klassischen Redegattungen (Gerichtsrede,
Politische Rede, Festrede), und das Auffinden aller
zur wirkungsvollen Behandlung des Gegenstands nötigen
Argumente und Materialien. Zu deren Erforschung hat
die Rhetorik ein eigenes System von Suchkategorien (Topik)
ausgebildet, die personen- oder problembezogen alle
möglichen Fundorte für Argumente, Beweise
oder sonstige Belege erschließen.
|
| Dispositio: |
Im zweiten
Arbeitsstadium hat der Autor die Gliederung des Stoffes
festzulegen. Dabei bildet die Frage nach der Angemessenheit
der Gliederung der Sache und dem Publikum ein wichtiges
Kriterium.
Mit der Lehre von den vier Redeteilen hat die Rhetorik
systematische Hilfestellungen für diese Aufgabe
entwickelt.
Die
vier Redeteile bestehen aus:
- Einleitung
(exordium),
- Darlegung
des Sachverhalts (narratio),
- Argumentation
und Beweisführung (argumentatio),
- Redeschluß
(conclusio, peroratio).
|
| Elocutio:
|
Das
dritte Arbeitsstadium umfasst die sprachlich-stilistische
Produktion der Rede. Die elocutio ist das differenzierteste
Teilgebiet der Rhetorik.
Es umfasst die Figuren und Tropen sowie Regeln für
den Wortgebrauch und die Satzfügung, soweit diese
nicht grammatischen, sondern stilistisch-rhetorischen
Zwecken dienen. Sprachrichtigkeit, Deutlichkeit, Angemessenheit
in Bezug auf Inhalt und Zweck der Rede, Redeschmuck
und Vermeidung alles Überflüssigen sind die
obersten Stilqualitäten. Um allen Wirkungsintentionen
zu entsprechen, hat die Rhetorik zum Teil sehr komplizierte
Stillehren entwickelt, doch allein die wohl auf Theophrast
zurückgehende Dreistillehre hat sich durchgesetzt
und beherrschte die Geschichte der europäischen
Beredsamkeit und Literatur bis ins 19. Jh.
Die Dreistillehre unterscheidet die schlichte, schmucklose,
sowohl dem belehrenden Zweck wie der alltäglichen
Kommunikation angepasste Redeweise, auf Unterhaltung
und Gewinnung der Zuhörer ausgerichtet ist. Sie
bedient sich des Redeschmucks auf eine temperierte Weise
und soll so eine sympathische Beziehung zwischen Redner
und Publikum herstellen.
Von diesen beiden abgesetzt wird als Alternative die
großartige, pathetisch-erhabene Ausdrucksweise,
die alle rhetorischen Register zieht und die Zuhörer
mitreißen will, gesehen. Sie ist besonders handlungsbezogen
und zielt auf Entscheidung und praktische Veränderung
aufgrund der zuvor durch Darlegung und Argumentation
erreichten Einstellungsveränderung oder -sicherung.
|
| Memoria:
|
Im
vierten Stadium konzentriert sich der Redner auf das
Einprägen der Rede ins Gedächtnis (memoria)
mittels mnemotechnischer Regeln und bildlicher Vorstellungshilfen.
|
| Actio: |
Das
letzte Produktionsstadium besteht in der Verwirklichung
der Rede durch Vortrag (pronuntiatio), Mimik, Gestik
und sogar Handlungen (actio).
Die Rhetorik entwickelte eine ausgefeilte Sprechtechnik,
Regeln zur körperlichen Beredsamkeit und in neuerer
Zeit eine Rhetorik der Präsentation und der medialen
Darbietung.
In diesem letzten rhetorischen Arbeitsstadium liegt
auch der Ursprungsort der Schauspieler- und Theatertheorien
sowie der "gesellschaftlichen Beredsamkeit",
wie A. v. Knigge seine Kunst des "Umgangs mit Menschen"
nannte. |
|

Rhetorische
Figuren und Topoi
(Sprachfiguren und feste Redewendungen)
Die Rhetorik hat
für die Gestaltung von Reden verschiedene Figuren und Topoi
entwickelt.
Die Lehre von den
Topoi und Figuren ist ursprünglich ein Teil der antiken Rhetorik,
daher spricht man von "rhetorischen Figuren". Es handelt
sich um eine Vielzahl von Stilmitteln, die in der antiken Gerichtsrede,
in der Literatur, in politischen Reden, Zeitungsartikeln, aber
häufig auch in der Alltagsrede verwendet werden.
Figuren
Grundsätzlich meint eine Figur die Ersetzung einer direkten
(natürlichen) sprachlichen Äußerung durch eine
kunstvoll (häufig bildhaft) veränderte.
Bildformen wie die Metapher, der Vergleich, die Allegorie etc.
gehören zu dieser Gruppe.
Topoi
Hierbei handelt es sich um eine rhetorische Formkategorie; Topoi
sind festgefügte Wendungen, Formeln, Bilder, die sich in
bestimmten Teilen der klassischen Rede anwenden lassen bzw. auf
bestimmte Themen passen.
Die Topik als Lehre von den Topoi gibt seit der Antike Möglichkeiten,
bestimmte Topoi aufzufinden.
Wichtige Informationen zur Rhetorik im Internet:
 www.uni-tuebingen.de/Rhetorik/
www.uni-tuebingen.de/Rhetorik/
Besonders interessant darin die folgenden Seiten:
Theorie und Praxis der Rhetorik
Studiengänge und Forschungsprojekte
Rhetorische Forschungsgesellschaften und Fachverbände
Text- und Redesammlungen

1.3 Wovon kann ich
lernen   Gesprächsanalyse Gesprächsanalyse
|