|
Um Konflikte richtig beurteilen und konstruktiv
angehen zu können, ist es nötig, zu
ihrem Kern vorzudringen. Dies aber ist häufig nur
schwer zu erreichen. Wir alle haben schon die Erfahrung gemacht,
dass Personen oder auch Gruppen lange und intensiv über eine
Sache streiten und davon überzeugt sind, dass es tatsächlich
um diese Sache geht.
|
Sieht man aber näher hin, stellt
man fest, dass dieses, sich auf der Oberfläche abspielende
Konfliktgeschehen letztlich nur vorgeschoben ist (vgl. das
Eisbergmodell.)
Es handelt sich um einen Scheinkonflikt, und darunter liegt
etwas anderes, das dem Bewusst-sein der Beteiligten gar
nicht zugänglich ist, vielleicht weil es als zu persönlich,
als peinlich empfunden wird.
Man muss sich das so vorstellen wie einen Eisberg, der im
Wasser treibt. Von ihm sieht man an der Oberfläche
nur ganz wenig, während der größte Teil
seiner Gesamtmasse unter der Wasseroberfläche verborgen
ist. Von vielem in unserem Leben kommt nur wenig an die
Oberfläche, das meiste ist sogar den Betreffenden ver-borgen.
|
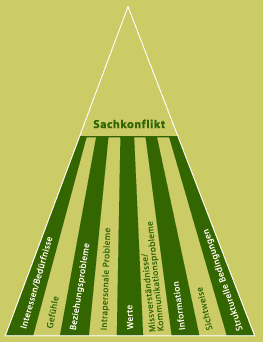
Eisbergmodell nach
Besemer
siehe
www.rpi-loccum.de/schstreit.html
|
Beispiele für verschobenene
Konflikte:
1. KRITIK AN DER ARBEIT
Herr Meier kritisiert an seiner Kollegin
Frau Müller ständig, dass diese ihre Arbeit nicht korrekt
oder zu langsam erledige. Frau Müller verteidigt sich vehement
gegen die Vorwürfe, weil sie sich keiner Schuld bewusst ist
und sich mit Eifer den ihr gestellten Aufgaben widmet.
Wollte man diesen Konflikt näher analysieren, wäre
zu fragen, ob die Vorwürfe tatsächlich eine sachliche
Basis haben. Ist dies nicht der Fall - wie wir annehmen wollen
- wäre festzustellen, was hinter den immer währenden
Vorwürfen steckt: Es könnte eine Unvereinbarkeit der
Personen - also das bekannte und schwer zu fassende
Gefühl von Antipathie sein - aber, wie häufig
im Berufsleben, auch eine latente Konkurrenzsituation
direkter oder indirekter Art: wer etwa in der Gunst der Vorgesetzten
ganz oben steht oder wer für eine baldige Beförderung
in Frage kommt.
2. DAS BESSERWISSER SYNDROM
Der siebzehnjährige Klaus ist in der Schule ausgesprochen
konkurrenzorientiert; er muss immer der Beste sein. Also korrigiert
er ständig die Antworten, die seine Mitschüler/innen
geben, besonders die Beiträge von Monika. Diese versucht
sich dagegen zu wehren und es kommt zu immer neuen Konflikten
um die Frage: Wer hat recht?
Wir nehmen auch hier an, es handelt
sich um einen verschobenen Konflikt:
Monika hat nicht permanent unrecht und Klaus recht. Auch hier
ergibt sich die Frage:
Was steckt dahinter?
Das könnte in diesem Falle etwa sein:
Der Charakter von Klaus:
Er ist schon in der Familie immer wieder mit Konkurrenzsituationen
konfrontiert worden, musste sich ständig gegen seine Geschwister
durchsetzen, wurde von den Eltern zu "Spitzenleistungen"
angetrieben.
Es kann sich aber auch um latente Minderwertigkeitsgefühle
handeln, die ihn dazu nötigen, sich ständig
selbst beweisen zu müssen.
Näheres dazu z.B. Teil 1 Kommunikationsstile: Der sich beweisende Stil
Teil 1 Kommunikationsstile: Der sich beweisende Stil
Die spezielle Beziehung
zu Monika:
Vielleicht möchte Klaus ihr - unbewusst - imponieren und
muss sie dazu zugleich degradieren. Oder aber er lebt versteckte
Rachegefühle aus, weil er sich dem Mädchen nähern
wollte und dabei eine Abfuhr erlitten hat.
3.6 Charaktereigenschaften beteiligter
Personen   3.8 Eskalation von Konflikten
3.8 Eskalation von Konflikten
|

